Chefgespräche
„Wir müssen den Kreis schließen“
Früher Alltag, heute Ausnahme: Die Runderneuerung von Pkw-Reifen fristet ein Nischendasein. AZuR-Koordinatorin Anna-Maria Guth sagt, woran das liegt – und was sich ändern muss
von Roman Winnicki

Willich. Was hat Usain Bolt mit alten Reifen zu tun? „Er ist darauf seinen Olympischen Rekord gelaufen“, sagt Anna-Maria Guth, Koordinatorin des europaweiten AZuR-Netzwerks. Die Tartanbahn im Londoner Olympiastadion, auf der Bolt 2012 Gold holte, bestand nämlich zu großen Teilen aus recyceltem Gummi. Im Chefgespräch erklärt sie, warum fehlende Standards, politische Versäumnisse und ein schlechtes Image verhindern, dass vielen Reifen ein zweites Leben geschenkt wird – und was sich aus ausgedienten Pneus sonst noch alles machen lässt.
Frau Guth, jedes Jahr fallen Millionen Tonnen Altreifen an. Warum wird so wenig runderneuert?
Guth: Da müssen wir zunächst unterscheiden. Lkw-Reifen werden zwei-, teils dreimal runderneuert – das ist etabliert. Selbst in der sicherheitssensiblen Flugzeugbranche ist das völlig normal. Bei Pkw-Reifen hinkt die Runderneuerung aber tatsächlich hinterher. In den 70er Jahren war das noch ganz anders: Autoreifen wurden häufig wiederaufbereitet, es gab einen funktionierenden Markt. Heute ist davon kaum etwas übrig.
Und das, obwohl die Runderneuerung viele ökologische Vorteile bietet. Was hat sie ausgebremst – der Preis oder ein schlechtes Image?
Guth: Beides. Asiatische Billigimporte haben die Pkw-Runderneuerung praktisch zum Stillstand gebracht. Wer heute für den gleichen Preis einen Neureifen bekommt, greift selten zur runderneuerten Variante. Nur wenige tun das aus Idealismus. Und dann ist da noch das Imageproblem: Ein paar negative Berichte in der Vergangenheit – und der Ruf war ruiniert. Das wirkt bis heute nach. Dabei werden Runderneuerte inzwischen industriell gefertigt und unterliegen strengen Qualitätsvorgaben.
Ein Problem dürfte auch sein, dass auf Runderneuerten bis heute das EU-Reifenlabel fehlt.
Guth: Genau. Das ist jene Kennzeichnung, die über Rollwiderstand, Nasshaftung oder Abrollgeräusche informiert. Das erschwert es natürlich, Vertrauen aufzubauen. Hinzu kommt bei den Pkws die enorme Vielfalt an Reifendimensionen. Diese wird von den Fahrzeugherstellern getragen, die eigene Sondergrößen auf den Markt bringen – oft ohne technische Notwendigkeit. Früher konnte man einfach zum Händler gehen, der hatte den passenden Satz auf Lager. Heute muss fast alles bestellt werden. Ein logistischer Wahnsinn – auch aus Nachhaltigkeitssicht. Für Runderneuerer ist das eine zusätzliche Hürde, für jede Dimension braucht es eigene Formen und Werkzeuge. Das macht die Produktion teuer und die Sortimente bleiben zwangsläufig begrenzt.
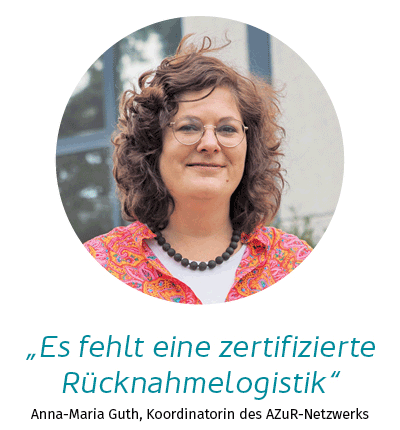
Nächste Baustelle: Elektromobilität?
Guth: Im Gegenteil, sie kann sogar ein Treiber werden. Elektroautos haben einen höheren Abrieb, was vor allem am höheren Gewicht und dem kraftvolleren Antrieb liegt. Das bedeutet, dass die Reifen nicht so lange halten wie bei Verbrennern, sie sind aber technisch noch jung. Gerade deshalb wäre es sinnvoll, sie künftig häufiger runderneuern zu lassen. Darin liegt ein enormes Potenzial. Die Runderneuerung könnte Arbeitsplätze schaffen und Fachkräfte binden, da sie nur regional funktionieren kann. Eine Runderneuerung im Ausland und der Rücktransport nach Deutschland lohnen sich weder ökologisch noch ökonomisch. Das macht nur hier Sinn. Dieses Geschäft gehört in die Hände regionaler Mittelständler.
Ein Pkw-Reifen hat nur zwei Leben. Warum ist das so?
Guth: Autos werden weniger gefahren als Lkws. Bis ein Reifen abgefahren ist, vergehen oft Jahre. Bei einer zweiten Runderneuerung wäre die Karkasse meist schon zehn Jahre alt – und damit zu alt, um noch ein neues Leben zu starten. Aus Sicherheitsgründen scheidet sie dann aus.
Was passiert danach? Ist der Reifen dann reif fürs Jenseits?
Guth: Nein, auf den Reifen-Friedhof kommt er damit nicht. Wenn eine Runderneuerung nicht mehr möglich ist, bleibt die stoffliche Verwertung, also die Vermahlung zu Granulaten. Die landen in Stallmatten, Messeböden, Antirutschbelägen oder werden als Füllmaterial in Kunstrasenplätzen eingesetzt. Manche machen sogar Rasensteine daraus, die sich zwischen Parkflächen legen lassen. Das Material ist robust, flexibel, vielseitig einsetzbar – und trotzdem wird noch viel zu oft einfach verbrannt. Teils hierzulande, teils im Ausland, und nicht selten illegal.

Das heißt: Viele Altreifen verschwinden einfach aus dem System?
Guth: Ja, denn es fehlt eine zertifizierte Rücknahmelogistik. AZuR fordert deshalb, dass nur noch zertifizierte Entsorger sammeln dürfen – mit Nachweispflicht. In Deutschland müssen Händler für schlechte Altreifen ein paar Euro zahlen. Deshalb kommt es vor, dass sie sie einfach „mitgeben“. So verschwinden die Reifen aus dem System. Ein Teil davon landet dann illegal außerhalb der Europäischen Union, etwa in der Türkei, in Pakistan oder Indien, wo sie als Ersatzbrennstoff dienen. Dabei darf Abfall aus der EU nicht ausgeführt werden. Dadurch entgehen unseren Betrieben relevante Mengen für neue Produkte. Es gibt sogar Unternehmen, die in Deutschland Altreifen aufkaufen wollen, um sie im Ausland zu granulieren und anschließend wieder nach Europa zu verkaufen. Das wäre ein absurder Stoffkreislauf.
Lässt sich der Kreislauf beim Reifen schließen?
Guth: Das ist unser Ziel und die Königsklasse der Kreislaufwirtschaft. Einen alten Reifen so zu recyceln, dass daraus ein neuer entsteht. Dafür braucht es jedoch sortenreines Material, das sich bei den vielen Gummimischungen in Reifen kaum trennen lässt. Daran wird intensiv geforscht, aber noch fehlen die entsprechenden Prozesse. Ein digitaler Produktpass würde auf dem Weg dorthin helfen: Wenn klar ist, welche Materialien im Reifen enthalten sind und ob er bereits runderneuert wurde, kommen wir dem Ziel ein Stückchen näher.
Ihr Fazit: Was muss sich ändern?
Guth: Wir müssen den Runderneuerten gleichstellen – beim Label, bei Ausschreibungen und in der öffentlichen Wahrnehmung. Außerdem sollten Altreifen nicht länger als Abfall, sondern als wertvoller Sekundärrohstoff gelten. Zum Glück ist die EU da bereits dran.
AZuR-Netzwerk – die Fakten
AZuR steht für Allianz Zukunft Reifen – ein Netzwerk mit über 90 Partnern aus Industrie, Handel, Wissenschaft und Entsorgung, das sich für die nachhaltige Verwertung von Altreifen einsetzt. Seit 2020 treibt AZuR Lösungen für Runderneuerung, Recycling und zertifizierte Rücknahmesysteme voran. Der Fokus liegt auf praxisnahen Kooperationen, politischer Aufklärung und einer funktionierenden Reifen-Kreislaufwirtschaft. Das Ziel ist die vollständige Verwertung von Altreifen.
